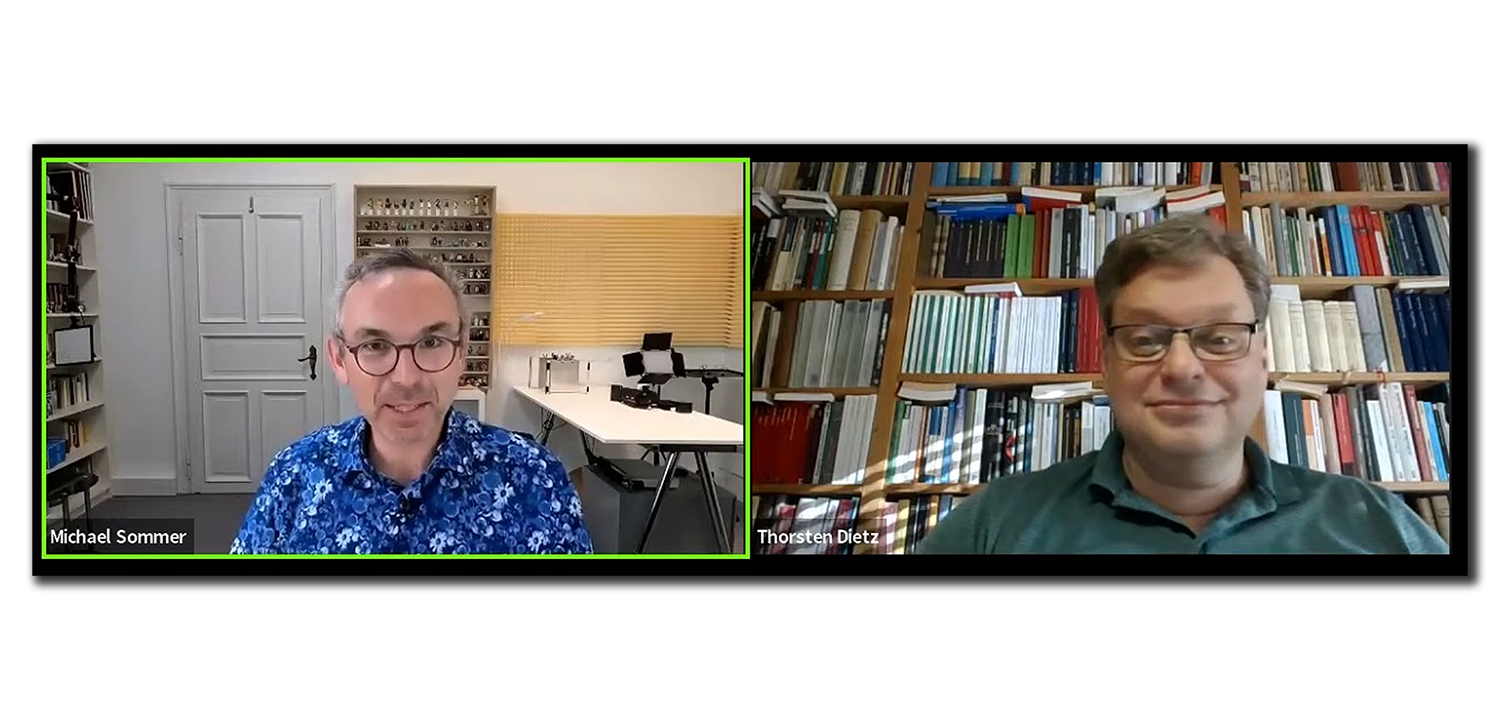Aus einem inFOyer-Gespräch zwischen Prof. Dr. Thorsten Dietz und Michael Sommer vom 18.07.2023. Das gesamte Gespräch ist hier auf YouTube verfügbar. Thorsten Dietz ist Pfarrer, hat viele Jahre als Dozent für Systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg gearbeitet, ist aber einer breiten Öffentlichkeit auch durch seine zahlreichen (im Internet verfügbaren) Vorträge über christliche Themen in der Worthaus-Reihe, seine Buchpublikationen und seine Podcast-Formate bekannt. Seit 2022 arbeitet Thorsten Dietz bei „Fokus Theologie“, dem Erwachsenen-Bildungswerk der Evangelisch-Reformierten Kirche der Schweiz.
Michael Sommer (MS): Was bedeutet „Schöpfungsordnung“, lieber Thorsten, im theologischen Sprachgebrauch?
Thorsten Dietz (TD): (…) Theologisch meint man damit, dass Gott der Welt von Anfang an Grundordnungen eingepflanzt hat, die nicht nur einfach so drin sind, sondern an die man sich halten soll. Der Mensch ist das Lebewesen, das zwar natürlichen Gesetzen unterworfen ist und ihm frei gegenübersteht, aber die göttlichen Ordnungen sind solche, die der Mensch in Freiheit bejahen soll. So und darunter versteht man ein Ordnungsgefüge, was sich durch die ganze Schöpfung zieht. Die Menschen sind in bestimmte Stände eingeteilt, sie sind geistlichen Standes oder damals adligen Standes oder Bürger oder auch unfrei, und sie müssen sich an ihre jeweiligen Regeln [halten]. Und es sind immer Regeln der Überordnung und der Unterordnung, der Verantwortung und der Fürsorge oder aber eben des Gehorsams und des Dienens, ob in der Familie oder in der Kirche oder im Staat. Die „Schöpfungsordnung“ zieht sich durch all diese Lebensbereiche. Gottes Wille hat diese Ordnung zum Leben gegeben, dass wir uns an sie halten.
MS: (…) Du hast jetzt auch von Fürsorge, aber eben auch von Unterordnung gesprochen, also von hierarchischen Verhältnissen, die da beschrieben werden mit diesem Begriff „Schöpfungsordnung“.
TD: Ja, genau, der Pfarrer kümmert sich um seine Gemeinde und versorgt sie geistlich. Ja, und er bekommt dafür eben (…) folgsame, willige Menschen, die zu seiner Gemeinde gehören. Die Obrigkeit, da hat man am besten einen Landesvater, der ist verantwortlich, der trägt vor Gott Verantwortung dafür, dass alles gelingt, (…) aber man muss ihm auch gehorchen. In der Familie ist es der Vater. Der Vater leitet die Geschicke. Er trägt Verantwortung für seine Frau, für die Kinder, die Frau trägt Verantwortung für die Kinder, die Kinder für die Ordnung im Spielzimmer oder wie auch immer. So, und jeder muss seiner Verantwortung gerecht werden. Und dann hat man Happy Family und auch sonst ein schönes Leben.
MS: Okay, und das sind drei Spielfelder. Der Staat, die Familie, die Gemeinde oder Kirche im weiteren Sinne. Wir haben jetzt hier eine Frage aus dem Chat: Ist diese Definition der „Schöpfungsordnung“ tatsächlich biblisch oder gesellschaftlich entstanden? Was können wir dazu sagen?
Ursprung des Begriffs „Schöpfungsordnung“
TD: (…) Natürlich gibt es in der Bibel sehr viele Ansätze solcher Ordnungsideen. So, aber das Gesamtkonzept einer „Schöpfungsordnung“ wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, (…) es ist eine ursprünglich lutherische Idee. Man spricht auch gerne vom Neuluthertum und in dieser Zeit hat das schon eine klare Stoßrichtung. Zum einen will man sich abgrenzen von der katholischen Idee des Naturrechts. (…) Und zum anderen will man sich abgrenzen von Aufklärung, Moderne, Liberalismus und Rationalismus, also gegen diese ganzen revolutionären Umtriebe. (…) Und da ist „Schöpfungsordnung“ einfach ein Wort, was ein Programm einschließt: Nicht kritisieren, nicht hinterfragen. Bestimmte Ordnungen sind von Gott so gewollt. Und dazu gehört die Monarchie, dazu gehört die patriarchalische Familie. Dazu gehört eben auch die Lehre und die Ordnung der Kirche. Und an all diese Ordnungen muss man sich halten.
MS: Also was du beschreibst, ist eine Art von konservativem „Backlash“ im 19. Jahrhundert, also eine Gegenbewegung gegen freiheitliche Tendenzen auf der philosophischen Ebene, also rationales, aufklärerisches Gedankengut, [auch] auf der theologischen Ebene und auf der politischen Ebene, wogegen dieser Begriff eingeführt wird. (…) Aber zwei Sachen vielleicht noch mal dazu. Das Wort „Schöpfungsordnung“ kommt in der Bibel nicht vor. So, und du sagst, es sind biblische Konzepte, auf die man sich beruft, aber es (…) gibt jetzt nicht die eine Stelle in der Bibel, wo wir sagen okay, und hier lesen wir: Das ist Gottes Schöpfungsordnung, oder?
TD: Nein, das gibt es ganz schlicht nicht. Es gibt diese unterschiedlichen Felder und Bereiche, ja auch Staat, Wirtschaft, Kirche und so. So, und da muss man aber sagen, die Vielfalt ist ja so furchtbar groß, was die Bibel alles über Familie sagt, was sie über Staatsordnung sagt, was wir im Alten Testament lesen, über Ordnung des Gottesdiensts, was wir im Neuen Testament finden. Also das hat noch keiner geschafft, das alles zu vereinheitlichen. Diese Idee, das möglichst einheitlich aus einem Guss zu kriegen. Da steckt auch viel Romantik drin im 19. Jahrhundert, diese Idee einer einheitlichen Kultur. Ein Volksgeist, eine „Schöpfungsordnung“, die sich dann irgendwie in der Welt in verschiedenen Varianten durchsetzt. Das ist aus heutiger Sicht schon auch schräg. Etwas.
MS: (…) Haben wir Informationen darüber, wo dieses Konzept konkret auftaucht, zum ersten Mal in der Debatte? Gibt es da Menschen, die das eingeführt haben, den Begriff der „Schöpfungsordnung“? Kannst du was dazu sagen?
TD: Das ist so eine Spurensuche. Eine Zeit lang sagt man Adolf von Harless, Erlanger Lutheraner, „Christliche Ethik“, hat das entwickelt. (…) Inzwischen gibt es ältere Belege: Theodor Kliefoth, ein Theologieprofessor, Rostock, Mecklenburger Raum oder ein Jurist Otto Meyer aus dem Hannoverschen. Es ist aber immer so Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Details sind komplex, es entwickelt sich, und stark wird es dann im 20. Jahrhundert vertreten von Paul Althaus und Werner Elert. Das sind Nachfahren der Erlanger Theologie. Die verwenden es dann im Grunde schon auch, um das Dritte Reich ansatzweise zu rechtfertigen. Elert ziemlich stark, Althaus eher im Ansatz – und (sie) verstehen jetzt auch Rasse, Blut und Boden als „Schöpfungsordnung“. Das hat die ganze Theorie im Grunde sehr diskreditiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man nur noch sehr vereinzelt auf sie zurückgegriffen. Eigentlich gilt der Begriff als ziemlich verbrannt aufgrund dieses ganz schlimmen Missbrauchs im 20. Jahrhundert.
Die Schöpfungserzählungen (Gen 1 und 2)
MS: (…) Jetzt kommen wir mal zurück zum Inhalt. Also der Begriff suggeriert, du hast das vorhin schon angesprochen, gesellschaftliche Ordnung und er kommt bei uns insbesondere im Kontext der Diskussion um die Ordination von Frauen vor. Und da wird gesagt, die „Schöpfungsordnung“ besagt, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. Das wollte Gott von Anfang an so, das war sein Plan bei der Schöpfung. Daher der Begriff „Schöpfungsordnung“. Nun muss man aber mal ganz trocken feststellen: Das steht so nicht in der Genesis. Könntest du etwas dazu sagen?
TD: Ja, das ist schon etwas, was sich so durch die Kirchengeschichte durchgezogen hat. Also dass in der Bibel die Frauen den Männern nachgeordnet sind. Da findet man schnell was, überall in der Thora an allen möglichen Stellen (…), aber wo kommt es her? Und da hat es im Grunde zwei Positionen gegeben Die einen sagten von Anfang an, von Anfang an war Adam der Erste, dann kam Eva. Es gibt eine ewige Über- und Unterordnung der Geschlechter, so, und dann gibt es aber eine zweite Auslegung der Bibel, die sich eigentlich heute durchgesetzt hat, auch im evangelikalen Bereich, die im Grunde sagt Genesis eins ist wirklich auffällig. Das ist ja schon interessant. Hier werden als Ebenbild Gottes bezeichnet der Mensch männlich und weiblich. Und das ist so verblüffend, dass beide genannt werden, eigentlich Ebenbild war immer der König, der Herrscher, der war Bild Gottes. Er war Statthalter. Jetzt ist es der Mensch. Das ist an sich ja schon eine Demokratisierung. Und wenn es heißt männlich-weiblich, heißt das im Sinne der Logik von Genesis eins: Alle, die ganze Menschheit. So wie Tag und Nacht, Land und Wasser, Himmel und Erde – ist immer das Ganze. Männlich und weiblich – der Mensch. Alle Menschen sind Ebenbild Gottes, ohne das hier abgestuft wird.Auch Genesis zwei (…): Es heißt ja dann nicht, dass Adam über Eva sagt „Oha, die steht ja weit unter mir und die kann ich beherrschen“. Sondern er sagt „Das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch“. Also die Ähnlichkeit wird betont. Unähnlichkeit war zwischen Mensch und Tier, Mann und Frau ist Maximum an Ähnlichkeit und Verständnis. So, und dann Genesis drei (…) nach diesem Riss, nach diesem Bruch wird es unter die Fluchfolgen gezählt. Die Folgen der Abwendung des Menschen von Gott, das ist hier im Wort an die Frau (…) ein bisschen kompliziert zu übersetzen, aber schon in dem Sinne: „Er wird dein Herr sein, er soll dein Herr sein.“ So, und das hat sich eigentlich durchgesetzt, dass man gesamtbiblisch sagen kann die ganze Bibel setzt das voraus, dass Frauen Männern nachgeordnet sind. Es gibt aber an entscheidenden theologischen Stellen die Einsicht, Das entspricht nicht (…) der ursprünglichen Idee Gottes, die er mit der Menschheit hatte.
MS: Also um das noch mal klar zu ziehen (…): In beiden Schöpfungserzählungen in Genesis eins und Genesis zwei, da kann man gut argumentieren, dass hier keine Unterordnung dokumentiert wird, sozusagen in diesen Erzählungen, sondern dass die Frau dem Mann in der zweiten Schöpfungserzählung zugeordnet wird und dass sie zueinander gehören (…), aber nicht im Sinne einer Unterordnung. (…)
Gesamtbiblisches Zeugnis
MS: Gut, jetzt sagen die Gegner der Frauenordination, dann ist (…) die Unterordnung der Frau halt nach der Schöpfung in die Welt gekommen, aber jetzt scheint das für Gott ja okay zu sein, oder? Also wir lesen ja im ganzen Alten Testament nicht und auch im Neuen Testament nur punktuell, dass Frauen mal in Führungspositionen sind. Also gut, im Alten Testament ausnahmsweise. Wenn gerade kein guter Mann da ist, dann dürfen die Frauen auch mal was machen. Debora oder so, aber wenn das die Regel ist, dass der Mann immer der Chef ist und die Frau immer sein Eigentum ist, dann muss Gott das doch wollen, oder? Was sagen wir dazu?
TD: Also was heißt Gott muss das wollen? Es ist so und es zieht sich ja wirklich auch durch die alttestamentliche Geschichte hindurch. So, und jetzt ist aber ja die spannende Frage: Du sagst Ausnahmen. Dann müsste es ja so sein, dass es zwar immer wieder mal Frauen gibt, die aus der Reihe tanzen, aber Gott müsste dahinter ja sein, das zu sanktionieren. Witzigerweise sehen wir das Gegenteil.
Das Buch Esther ist einfach sehr interessant. Esther 1 empfehle ich sehr zur Lektüre wird im persischen Weltreich beschrieben Ein König im Suff will seine Frau zur Schau stellen, weil er es kann und alle Männer grölen. Und die will das nicht so, die will das einfach nicht. So, und dann ist er beleidigt, empört. Fragile Männlichkeit, Krise und so, sie wird verstoßen, sie wird vom Thron vertrieben. So, und er sagt: Das soll an alle mitgeteilt werden. Jetzt müssen wir wissen Das persische Weltreich war flächenmäßig das größte Weltreich aller Zeiten. Es war ein Viel-Viel-Vielvölkerreich. Auch Juden gehörten dazu. So, und am Ende heißt es Esther eins, letzter Vers: „Damit alle wissen und sich daran halten, dass ein jeder Mann Herr in seinem Hause ist.“ Ende des Kapitels. Und das ganze Buch handelt davon, wie Gott eine Frau gebraucht, heilsgeschichtlich hier eine große Wende zu betreiben.
Und das ist halt öfter der Fall, dass Gott immer wieder an entscheidenden Stellen Frauen nimmt. Er hätte ja auch mit Josef über Maria reden können und sagen: „Hier, ich habe da was vor und so, Deine Verlobte, sag ihr mal, wie das – ich kann ja nicht mit einer Frau reden. Ich bin Gott, du liebes Bisschen. Dafür habe ich dich.“ Nein, Er redet mit der Frau, mit Maria. Wir haben Debora. Wir haben Hulda. Wir haben Richterinnen. Wir haben Prophetinnen. Wir haben im Neuen Testament Priska und Aquila. Meistens wird sie vor ihm genannt. Also, es gibt ständig Frauen, die quasi aus der Reihe tanzen. Warum ist Maria Magdalena die erste Zeugin der Auferstehung? Komisch. Komisch, Komisch. Warum sagt sie es den anderen? Und Joel drei ist dafür ein Schlüssel. Joel drei, Prophetie, wo das Wort ergeht: „Es soll eine Zeit kommen, der Geist Gottes wird ausgegossen“ und dann heißt es „Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, Mägde und Knechte“, also männlich und weiblich, wieder gemeinsam, gemeinsam Gottes Erkenntnis, gemeinsam Zeugnis. Und man kann im Grunde sehen, wie das in der Bibel bereits stattfindet. Eine solche Wiederherstellung, ein solches Zurück zur ursprünglichen Idee der gleichberechtigten Gemeinschaft von Frauen und Männern.
Paulinische Briefe (1. Tim, 1. Kor)
MS: Okay, also dann würden wir sagen: Naja wieso Ausnahme? Da steht ja nicht, dass es eine Ausnahme ist, sondern das ist genauso eine Möglichkeit wie dass David oder sonst irgendjemand Gottes Instrument ist (…). Du bist jetzt ins Neue Testament gesprungen, mit einigen Kronzeuginnen sozusagen. Dann würde ich gerne in diesem Zusammenhang noch mal auf einen Paulusbrief zu sprechen kommen, nämlich den 1. Timotheusbrief. Da gibt es eine Stelle, da (…) wird als Argument dafür, dass Frauen nicht lehren dürfen und dass Frauen in der Gemeinde schweigen und sich ihrem Mann unterordnen sollen, wird als Argument gebraucht, dass Adam zuerst geschaffen wurde und das sei dann der Grund dafür, dass er übergeordnet ist, mehr wert ist, mehr zu sagen hat auf jeden Fall. Das ist jetzt eine Interpretation der Genesis, die, wie wir gerade festgestellt haben, so nicht da steht in den ersten beiden Kapiteln der Genesis, aber das ist ja auch verbindlich, ist ja auch ein Teil der Bibel. Dieser Timotheusbrief. Und wenn das doch da so klar steht als Interpretation dieser, Genesis, dann müssen wir (…) das doch machen, oder?
TD: Ja, das müssen wir ernst nehmen. Die andere Stelle, die immer angeführt wird, ist 1. Korinther 14. So, da heißt es, die Frauen sollen schweigen. Sie sollen nicht hier lehren, predigen, verkündigen. Im 1. Timotheus noch weitergehend Sie sollen nicht Lehren im Sinne von keine Autorität ausüben über Männer. So 1. Korinther 14 wird sich auf das Gesetz berufen. Hier wird wieder auf die Thora zurückgegriffen. Adam vor Eva. So, und jetzt könnte man sagen: Eigentlich ist der Fall doch damit klar – hätten wir nicht die ganzen vielen anderen Stellen, wo wir sehen – 1. Korinther 11: Frauen predigen. Sie schweigen gar nicht, sie predigen und Paulus sagt: Ja, aber bitte nicht ohne Kopfbedeckung. Frauen lehren die, die Priska macht das mit ihrem Mann zusammen. Frauen werden in verschiedenen Ämtern vorgestellt.
Diakonin Junia als Apostelin im weiteren Sinne wahrscheinlich (ein bisschen unklar, was das meint). Aber all das gibt es ja so, dass wir hier im Grunde vor einem interessanten, auch herausfordernden Befund stehen. Es gibt im Neuen Testament Verse, die, sagen wir mal, eine Befreiungslinie weiterführen und richtig auch mit Schwung versehen. Galater 3,28: In Christus nicht männlich und weiblich. So, es gibt einige Stellen – weniger übrigens, weniger – die sehr klar noch mal die Zurückstellung der Frauen hinter die Männer betonen. Und da muss man sich was drauf reimen. Da finde ich es jetzt auch zu billig zu sagen: „Ach, wenn die Bibel nicht klar ist, suche ich mir einfach aus, was mir besser gefällt.“ Also so kann man mit der Bibel nicht umgehen. Da muss man ehrlich überlegen, warum steht das hier so und warum steht das da so und was machen wir damit?
Zwei Argumentationslinien bei Paulus
MS: (…) Widerspricht sich dann Paulus selbst?
TD: Jeder kann doch einfach mal zur Probe 1. Korinther 11 lesen, Verse 1 bis 12. Ja, Paulus widerspricht sich selbst. Er folgt unterschiedlichen Linien. 1. Korinther 11 hat er auf der einen Seite eine Linie, wo er sogar sagt: Die Frauen sind nicht Ebenbild Gottes wie der Mann. Der Mann ist Gottes Ebenbild im Vollsinne. Die Frauen sind nur ein Abbild des Mannes. So, und da sagt er: Die Frau ist um des Mannes willen geschaffen, der Mann aber nicht um der Frau willen. So, und dann fällt er sich ins Wort und sagt: Aber im Herrn, in Christus, ist weder die Frau etwas ohne den Mann noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn die Frau vom Mann und der Mann durch die Frau und alles von Gott. Also, es ist widersprüchlich, und es sind in Paulus offensichtlich zwei Stimmen in seiner Brust. Auf der einen Seite das Erbe im hellenistischen Judentum, das teilweise sehr, sehr patriarchalisch war. Philo von Alexandrien. Man könnte weitere Stellen nennen, Jesus Sirach und aber eben auch die frühe Jesusbewegung, wo Frauen eine andere Stellung hatten, als es weitgehend sonst üblich war. Und Paulus leuchtet das auch ein, und er vertritt es ja auch selbst. Und es gibt manchmal Stellen, wo sich das in ihm reibt. Im ersten Korintherbrief ist das am allerdeutlichsten zu sehen. (…) Also ich finde, Paulus ringt wirklich selbst mit dem Thema und ich glaube aber, es gibt doch einen guten Schlüssel, wie man es am Ende sortieren kann. Und der Schlüssel ist doch ganz einfach. Also da, wo er die Gleichheit von Frauen und Männern betont, redet er immer von Christus. Und das ist das, was ihm von Christus her einleuchtet. Und auf der anderen Seite ist Paulus kein Revolutionär für alle möglichen sozialen Ordnungen, sondern sein Ziel ist, dass Hauptsache Christus verkündet wird. Und ansonsten, so schreibt es auch im ersten Korintherbrief, sagt er: „Ich bin allen alles geworden, den Juden einen Juden, den Griechen einen Griechen.“ Also es gibt bei Paulus ein klares Bewusstsein dafür, sich in vielen Fragen immer wieder anzupassen, einzubringen in den Kontext, dass das Evangelium von Christus im Zentrum steht. Und manchmal setzt er die Akzente dann so, dass das in der Gemeinde klare Konsequenzen hat: Neuordnung des Lebens nach der Logik dessen, was wir in Christus sehen, zum Beispiel auch Freie und Sklaven in der Gemeinde, möglichst keinen Unterschied, möglichst Einheit – Onesimus, Philemonbrief und so. Auf der anderen Seite aber immer auch die Warnung: Dreht jetzt nicht durch. Keine Schwärmerei, keine Überspanntheit, sondern versucht auch einen guten, vernünftigen Eindruck für die draußen zu machen. Gerade in den Briefen an Timotheus und Titus ist das ein Hauptanliegen von Paulus. Das sagt er mehrfach. Lebt so, dass ihr einen guten Ruf draußen habt. Gebt keinen Anlass, dass über euch gelästert wird. Der Sklave soll gehorchen, ihr sollt nicht verlästert werden. Die Frau soll sich unterordnen, damit Gottes Wort nicht verlästert wird. Und ich glaube, so kann man es gut auflösen. Es gibt die konservativen Passagen, mit denen Paulus im Grunde sagt: Zurück zur gesellschaftlichen Konvention. Zurück zu dem, was im Judentum üblich ist. Jetzt keine Überspanntheit. Und es gibt die anderen Stellen, wo er im Grunde den Impulsen der Befreiung durch Christus folgt. Und die sprechen dann immer für die Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Was heißt das für uns heute?
MS: (…) Super. Und jetzt müssen wir das Ganze noch mal kurz auf heute anwenden. Denn wenn die große Strategie des großen Apostels Paulus ist: Wir haben hier Christus zu vertreten und dessen Botschaft und ansonsten wollen wir hier mal keine Sozialrevolution betreiben. Wir wollen nicht die Gesellschaft umkrempeln, sondern wir sind fürs Seelische zuständig, ja? Für die christliche Botschaft. Was heißt das für uns heute?
TD: Im Grunde müsste man heute die umgekehrte Folgerung aus dem ziehen. Also wenn heute Gemeinden sagen, bei uns haben Frauen nichts zu sagen, bei uns reden nur Männer, gibt es ganz, ganz viele Zeitgenossen, bei denen das Anstoß erregt. Und die sagen: Ihr seid doch nicht mehr ganz normal oder so. Also es verhindert ja, dass das Evangelium gehört werden kann. Wenn wir Paulus ernst nehmen, müssten wir aus denselben Gründen, wie er teilweise etwas gegen lehrende Frauen sagt, im Grunde sagen, um des Evangeliums willen müssen wir gleichberechtigt leben. Das sind doch Adiaphora, das sind doch Fragen, an denen es nicht hängen kann, wer jetzt gerettet wird oder nicht. Aber das hilft den Menschen, sich überhaupt auf die Botschaft zu konzentrieren und nicht abgestoßen zu werden von einer Lebensform, die eigentlich 19. Jahrhundert ist.
MS: Dass dieses Gedankengut aus dem 19. Jahrhundert kommt, da haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen. Und ich finde, die Tatsache, dass das tatsächlich Adiaphora sind, zeigt sich ja auch ganz deutlich an den vielen unterschiedlichen Strukturen, die es in der Gemeindeleitung und in der Organisation von Gemeinden im frühen Christentum gibt. Es ist ja nun keineswegs so, dass von Anfang an immer irgendwo ein Mann sitzt und sagt: Ich sage euch, wie’s geht und Frauen – Klappe halten.
TD: Genau, und das ist ja die große Chance, sage ich mal, einer lutherischen Prägung. Also das ist ja nun wirklich Confessio-Augustana-Urgestein zur wahren Einheit der Kirche ist es genug, dass man übereinstimme in Lehre des Evangeliums und Verwaltung der Sakramente, weil man im Grunde gemerkt hat in der Reformation, man kann aus der Bibel keine ewige Ordnung der Gemeinde ableiten. Schon so schlichte Fragen wie Synoden ja oder nein? Welche Ämter? Bischof, Pastor, Diakon? Ist das wirklich so? Ist es nicht so? Welche Rolle haben hier die Laien? Mitbestimmung? Gibt es überhaupt Laien – gibt es eigentlich gar nicht. Priestertum? Also man merkt im Grunde, man muss zeitgenössische Lösungen finden, die sich irgendwie auch einpassen ins Ganze. Und man wäre übelst beraten, aus der Bibel eine einheitliche Gemeindeordnung oder auch Gottesdienstordnung für alle Zeiten abzuleiten. Das funktioniert alles gar nicht. Und da war es immer reformatorische Freiheit zu sagen wir finden die Ordnungen, die passend sind, passend in dem Sinne, dass sie das Evangelium und seine Verkündigung unterstützen, so und sind im Zentrum im Evangeliumsglauben miteinander verbunden.
Zusammenfassend: Die Überwindung von Sünde und der Ungerechtigkeit
MS: (…) Vielleicht darf ich noch mal so zwei zusammenfassende Gedanken formulieren, die ich gerne mitnehmen möchte aus unserem Gespräch. Und das eine ist also es gibt eine Entfernung vom ursprünglichen Plan Gottes. Und dieser ursprüngliche Plan Gottes ist in Freiheit und Gleichberechtigung auch der Geschlechter miteinander zu leben. Es hat noch andere Aspekte, aber ist für unser Anliegen jetzt gerade interessant und mit der Entfernung von Gott, mit der Sünde, die in die Welt kommt und die die Menschen immer wieder von diesem Plan Gottes entfernt, kommen eben auch solche Dinge wie Hierarchien, Ungerechtigkeiten, Gewaltherrschaften und dazu gehört ganz klar auch die Unterdrückung der Frau in vielen Bereichen. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Und wir sehen immer wieder Spuren davon, wie diese Sündenordnung überwunden werden kann. In der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und wenn hier das Gedankengut des Patriarchats bedient wird, beispielsweise in den Paulinischen Briefen, dann hat das unter Umständen ganz pragmatische Gründe, nämlich wir wollen uns für Christus einsetzen, und deswegen wollen wir hier nicht als Sozialrevolutionäre gebrandmarkt werden. Fasst es das zusammen?
TD: Genau. Und ich würde schon auch sagen, es ist tragisch, wie stark die Kirche dann da stehen geblieben ist. Ich glaube, sie hätte viel früher und viel länger revolutionär sein müssen. Heutzutage finde ich es dann fast gar nicht begreiflich, wie manche Menschen im Grunde sagen: „Schöpfungsordnung“ ist doch ganz klar, aber eigentlich nur noch Gemeinde und Familie meinen. Und das ist dann auch nicht mehr konsequent. „Schöpfungsordnung“ war Staat, war Rechtswesen. Man müsste im Grunde auch gegen Demokratie, gegen Menschenrechte, gegen berufstätige Frauen insgesamt sein, gegen Wahlrecht der Frauen nicht nur, sondern Wahlrecht überhaupt So, und das ist ja kaum einer, weil es nicht konsequent ist, weil es nicht mehr funktioniert. Hier mehr Mut zu haben, dem Wandel der Zeiten doch auch zuzutrauen, dass Gott seine Finger drin hat. Wäre schon auch schön und ich finde auch reformatorisch.
MS: Was für ein guter Appell. (…) Was wünschst du dir für die Zukunft der Kirche, deiner Kirche, möglicherweise auch so einer kleinen Randkirche wie der SELK?
TD: Ach, ich wünsche mir für die Zukunft der Kirchen ja, dass wir Engführung und Fehler der Vergangenheit nicht verkleistern, uns da nicht wegducken, sondern uns wirklich auch stellen. Buße und Erneuerung ist immer eine Freude, weil auch die Selbsterkenntnis von Irrwegen uns ja letztlich dem näher bringt, was Gottes Gnade für uns ausmacht, so dass wir dann aber auch Schritte machen in Richtung größere Gerechtigkeit, wie wir miteinander umgehen, ob das Männer und Frauen sind, aber auch so Fragen wie Rassismus und Kolonialismus, da haben wir alle zu tun und das ist auch gut so und für die SELK würde ich mir doch wünschen, die SELK ist ja doch Erbin zweier revolutionärer Impulse der Reformation und eben auch des 19. Jahrhunderts, wo die Vorgängerkirchen gesagt haben: Wir lassen es uns nicht gefallen, dass ein Monarch unsere Bekenntnisstruktur, unsere Gottesdienste verändert, dann machen wir uns selbstständig. Das ist ein urliberaler Gedanke. Das ist modern, das ist progressiv. Und diese Modernität auch einfach mal anzunehmen, die Modernität der Reformation und der des Liberalismus im 19. Jahrhundert, dem man sein eigenes Dasein verdankt und so sich dieser doppelten Modernität nicht zu schämen, sondern zu glauben: Das Wort Gottes weist immer voraus in eine Zukunft, für die es noch keinen Plan gibt, aber eine Verheißung. Das würde ich der SELK wünschen.
MS: Das ist ein wunderbarer Wunsch. Vielen Dank.
/// Und hier das Gespräch im ungekürzten Original: