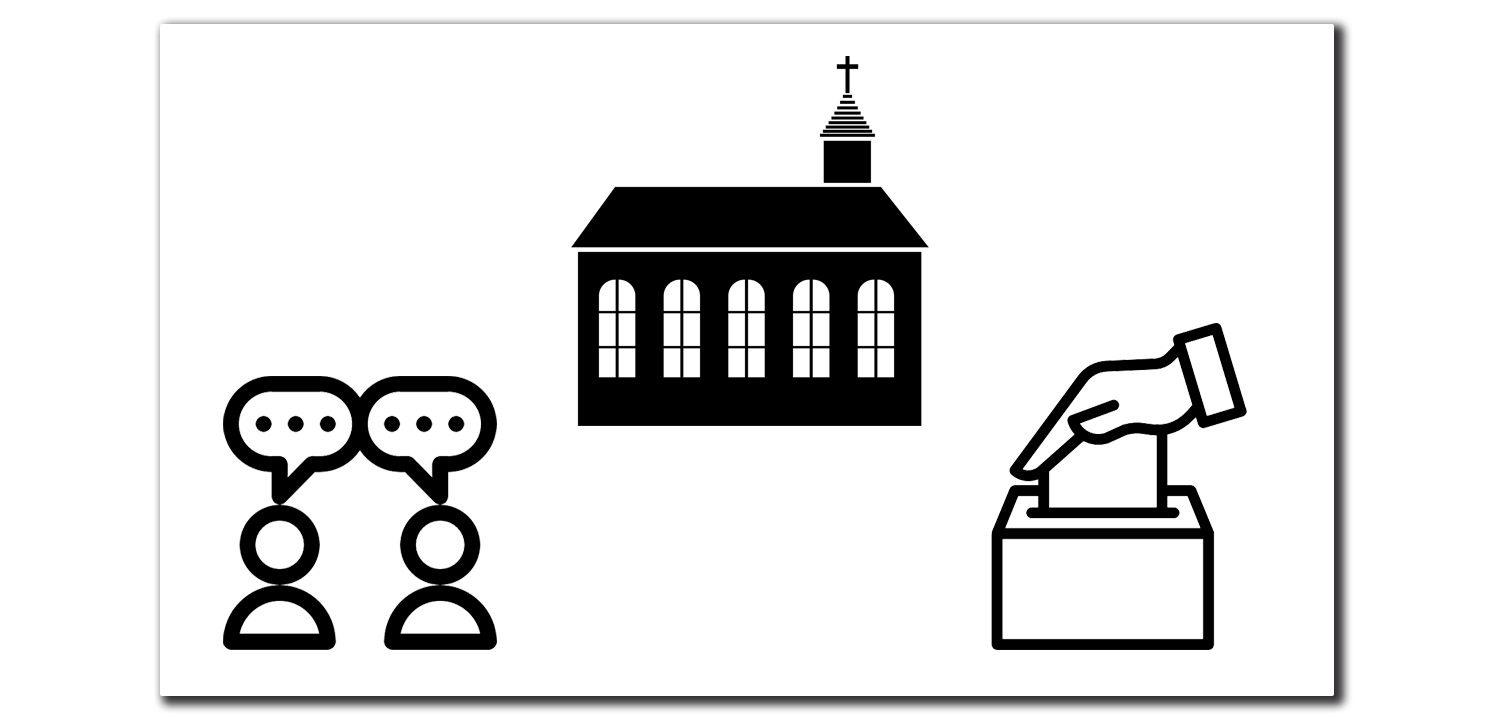Vortrag von Propst Manfred Holst, gehalten am 10.09.2022 in Bochum.
1. Vorbemerkung
Der Titel des Vortrags verdankt sich eines Buches von David Jordahl aus dem Jahr 1993 mit dem Titel „Die zehn Ängste der Kirche“[1]. Das Thema „Kirchen und ihre Angst vor Demokratie und Konflikt“ führt unmittelbar in eine persönliche und in eine grundsätzliche Ebene. Angst ist eine der fundamentalen Emotionen des Menschen und hat eine herausragende Bedeutung für unser Menschsein und deshalb eben auch in unserem Christsein. Angst hat eine bewahrende und ebenso im negativen Fall eine bedrohende Seite. Insofern ist es gut, sich mit eigenen Ängsten sowohl im persönlichen als auch in beruflichen oder kirchlichen Kontexten zu befassen. Die grundsätzliche Ebene betrifft die Kirche insofern Menschen in Kirchen leben, in ihnen arbeiten und in bestimmten Aufgaben Verantwortung übernehmen mit den damit verbundenen Entscheidungen. Auch auf dieser Ebene bekommen wir es mit Angst zu tun. Angst vor zu viel Veränderung oder zu viel Stillstand, Angst vor der Zukunft oder dem Konflikt. Dazu kommen weitere Ängste, die in allen Kirchen Raum gewinnen, die mit der abnehmenden „Kirchlichkeit“ in der Gesellschaft und den Kirchenaustritten zu tun haben. Strukturveränderungen wie zum Beispiel Pfarrbezirkszusammenlegungen werden notwendig, da zu wenig Personal im geistlichen Dienst vorhanden ist und Gemeinden weiterhin betreut werden müssen. In diesem Vortrag möchte ich zunächst das Thema „Demokratie und Kirche“ in den Blick nehmen. Dabei geht es sowohl um die Demokratie als Regierungsform als auch um die Demokratie in der Kirche selbst und in ihren Strukturen. Damit verbunden ist jedoch immer die Frage, wie mit Konflikten umgegangen wird in der Kirche und in der Gesellschaft. Im Anschluss daran versuche ich für das Gespräch im Umgang mit der Demokratie heute im kirchlichen Raum der SELK zu verstärken.
2. Die evangelisch-lutherische Kirche und ihr Verhältnis zur Demokratie
2.1. Der Begriff „Demokratie“
Christen und die Kirchen sind hineinverwoben in die Geschicke und die Geschichte ihrer Länder und Nationen. So verteidigen viele westlich orientierte Christen die westlich geprägte Demokratie, andere wiederum sehen in ihrer eher autoritären Demokratie den richtigen Weg, ein Land zu führen. Damit wird deutlich, dass es nicht „die“ Demokratie gibt. Demokratie ist ein zu füllender Begriff, was daran zu erkennen ist, dass zum Beispiel von einer repräsentativen, einer parlamentarischen, einer postmodernen, einer freiheitlichen, einer rechtsstaatlichen oder einer präsidialen Demokratie gesprochen wird.[2] Ich beschränke mich hier aus Zeitgründen auf die sogenannte freiheitliche oder rechtsstaatliche Demokratie, wie sie im Grundgesetz Deutschlands verankert ist. Grundelemente dieser Demokratie sind Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Gewaltenteilung, das Repräsentationsprinzip, das Mehrheitsprinzip, die Willens- und Regierungsbildung im demokratischen Prozess. Besondere Merkmale der so verstandenen Demokratie sind Partizipation, Repräsentation und Inklusion. Partizipation meint die Bürgerbeteiligung an demokratischen Entscheidungen. Repräsentation meint, dass Volksvertreterinnen und Volksvertreter durch Wahlen bestimmt werden für ein befristetes Mandat, so dass Herrschaft auf Zeit verliehen wird. Inklusion meint die „Gleichheit aller Bürger und den Einbezug aller gesellschaftlicher Gruppen“[3]. Für viele Menschen ist Deutschland bis heute weltweit ein „Sehnsuchtsort“[4], weil hier eine offene und konfliktfähige Demokratie gelebt wird. Und noch eine Erkenntnis ist zu betonen: Eine funktionierende freiheitliche Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss errungen werden.
2.2. Die Stellung der Kirchen zur Demokratie
Heute haben viele Kirchen in Deutschland und Europa grundsätzlich ein positives Verhältnis zur Demokratie.[5] So wird in der auch von der SELK unterzeichneten Charta Oecumenica formuliert: „Als Kirchen wollen wir gemeinsam den Prozess der Demokratisierung in Europa fördern. Wir engagieren uns für eine Friedensordnung auf der Grundlage gewaltfreier Konfliktlösungen. Wir verurteilen jede Form von Gewalt gegen Menschen, besonders gegen Frauen und Kinder.“[6] Diese klare Unterstützung der demokratischen Staatsform ist seitens der Kirchen nicht selbstverständlich. So hat Bundeskanzler Helmut Schmidt in einem Interview 1981 auf die Frage, ob es seiner Meinung nach in den Kirchen ein Defizit im Blick auf den Umgang mit der Demokratie sehe, folgendes gesagt: „…. die Theologie habe es bisher noch nicht fertiggebracht, die Demokratie wirklich in sich aufzunehmen. Beide Kirchen seien damit bisher kaum richtig fertig geworden, sie fänden es manchmal schwer, der allzu menschlichen, fehlerhaften Demokratie einen Vertrauensvorschuss einzuräumen. Und da sie die Demokratie noch nicht in ihr Herz aufgenommen hätten, seien die Kirchen auch nicht die besten Anwälte, um das Vertrauen der Menschen in die Demokratie zu festigen.“[7] Helmut Schmidt weist darauf hin, worin diese Distanz zur Demokratie begründet ist. Er behauptet, dass es für Theologen schwer anzuerkennen sei, „dass politische Entscheidungen von grundlegender Bedeutung aus allgemeinen Wahlen hervorgehen und dass Mehrheiten entscheiden können, die völlig im Unrecht sein mögen, während die Minderheit im Recht sein möge“[8] Für Theologen sei es, so Schmidt, eine „greuliche“ Vorstellung, dass Glaubensfragen mit Mehrheit entschieden werden können. Natürlich ist es nicht möglich, mit Mehrheiten in einer Kirche über Wahrheit entscheiden zu wollen. Jedoch haben Kirchen schon immer entschieden, was in der Kirche gelten soll und wenn es gut geht, auch begründet, warum bestimmte Entscheidungen mit Bibel und Bekenntnis konform sind. Hier kündigt schon das Thema an, dass Macht und Einfluss nicht nur in weltlichem Kontext eines Staates, sondern auch in den Kirchen jahrhundertelang von wenigen, von besonderen Gruppen oder einzelnen Personen ausgeübt wurde. Die genannten Vorbehalte sind bis heute erkennbar auch wenn viele Kirchen heute ihre Positionen zur Demokratie positiver formulieren als in früheren Zeiten. So formuliert der frühere EKD Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm: „Die Kirchen haben nicht nur längst ihre skeptische Haltung gegenüber der Demokratie überwunden…“[9] Diese positive Beurteilung der Demokratie findet sich vom Grundsatz auch in der römisch-katholische Kirche seit der Enzyklika Pacem in terris, in der Papst Johannes der XXIII. 1963 erstmals die Menschenrechte anerkennt und damit eine tiefgreifende Wende in der Kirche einleitet.[10] Dass Christen und Kirchen jedoch weiterhin die Demokratie in Frage stellen und sogar gefährden, zeigt sich auch an der Unterstützung des Präsidenten D. Trump durch vor allem konservative evangelikale Christen.[11] Gerade in sogenannten „frommen“ Kreisen gibt es einen bis heute wirkenden Antimodernismus, der auch die Demokratie in Frage stellt. Ein weiteres Beispiel einer mindestens missverständlichen Äußerung im deutschen Kontext findet sich in der Predigt des früheren sächsischen Bischof Carsten Rentzing nach dem Einzug der AFD in den Bundestag. Er würdigte die Mitarbeit der AFD im Bundestag als „Ausdruck der Vielfalt unserer Gesellschaft“. Dazu muss man jedoch wissen, dass Alexander Gauland von der AFD nur einen Tag vorher davon sprach, Angela Merkel zu „jagen“ und sich „unser Land zurückzuholen“.[12] Das ist eine politische Aussage, in der nicht eine demokratische Vielfalt anerkannt, sondern kompromisslos die Durchsetzung eigener Macht angestrebt wird.
2.2.1. Geschichtliche Hintergründe
2.2.1.1. Biblische Hintergründe
Eine demokratische Ordnung lässt sich ebenso wie eine ständische Ordnung kaum aus dem Neuen Testament ableiten. Der Begriff „Volk“ findet sich im Neuen Testament nur in der Apostelgeschichte und meint dort eine „Öffentlichkeit in einem nicht genauer definierten Rahmen (Act. 12,22, 17,5, 19,30f).[13] Im Anlehnung an Prof. Dr. Jorg Christian Salzmann Ausführungen in einem Vortrag von 2018 können die neutestamentlichen Aussagen zum Verhältnis von Religion und Politik folgendermaßen zusammengefasst werden[14]: Jesus wollte keine politische Macht und hatte keinen Staat auf Erden zum Ziel. Das Heil, das Jesus wirkte und verkündete, war jedoch nicht ohne weltlichen Bezug. So wendete er sich den Armen, Kranken und Ausgestoßenen zu und verkündete ihnen die Gnade Gottes. Das Evangelium veränderte auch die Beziehungen der Menschen zueinander. Jesus verzichtete auf Gewalt. Die Unterordnung unter die staatlichen Mächte wird begrenzt, wenn sie sich offen gegen Gottes Willen stellen. (Apg. 5,29) Das Neue Testament mahnt dazu, kein Unrecht zu tun, sondern im konkreten Fall zu erdulden. Die Hoffnung der Christen richtet sich auf die Macht Gottes und die Wiederkunft Jesu. Auch wenn das Neue Testament keine Staatslehre und keine allgemeine Ethik des Regierens kennt, finden sich Ansätze zu einer Staatslehre, insofern Herrscher Gutes fördern und Böses bestrafen sollen. Gott selbst hat den Herrschenden ihre Macht verliehen, vor dem sie sich verantworten müssen Christen haben eine Distanz zum Staat, die in der Nachfolge Jesu begründet ist; sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. So muss festgehalten werden, dass sowohl in den antiken als auch in den mittelalterlichen Gesellschaften in keiner Weise das Volk als Souverän gesehen wird, wie in der neuzeitlichen Demokratie. In der Demokratie ist das Gegenüber von Herrscher und Beherrschten abgelöst. Bürgerinnen und Bürger sind in der Demokratie in eine gewisse politische Mitverantwortung einbezogen.[15] Dennoch findet sich schon von Anfang an in der christlichen Gemeinde eine neue Struktur und ein vom Geist Gottes geleitetes Leben im Miteinander. Von Anfang an hat christlicher Glaube auch eine kritische Distanz zu jeglicher Politik, indem bestimmte Werte formuliert und gelebt wurden: Begrenzung politischer Macht (gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist) – soziales Engagement besonders für Schwache und Kranke – Verantwortung des Handelns vor Gott. Urchristliche Prozesse und Entscheidungen setzen Dialog und Argumente voraus. So gibt es zum Beispiel sowohl den sogenannten Apostelkonzil, in der eine Vorform synodaler Strukturen zu erkennen ist. Die geistliche Gleichheit aller Getauften formuliert Paulus im Galaterbrief 3,26-28: „Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 28 Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. 29 Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.“[16] Nicht zuletzt wird unter anderem in den paulinischen Briefen deutlich, dass die Gemeinde von Gott mit vielfältigen Gaben und Aufgaben und Ämtern beschenkt ist, in der Christus das Haupt der Kirche ist. Auch in solchen Stellen wird meines Erachtens deutlich, dass es in Kirche und Gemeinde um Grundelemente geht, die auch für die Demokratie von Bedeutung sind. So lebt die Gemeinde von der Partizipation am Aufbau der Gemeinde und der Vielfältigkeit der Gemeindeglieder, in der jeder einzelne Verantwortung und Aufgaben wahrnimmt.
2.2.1.2. Die Reformation[17]
Die Reformation ist primär eine geistliche und theologische Bewegung gewesen, die zunächst mit einer theologischen Debatte begonnen wurde. Soziale und politische Veränderungen konnten jedoch nicht ausbleiben, da die kirchlichen Auseinandersetzungen direkt die Menschen und ihre Lebenssituation betroffen haben. Weil es der Reformation nicht um ein politisches Programm ging, ist es nachvollziehbar, dass es ein langer und schwieriger Weg war, der von der „Toleranz zur Glaubens- und Gewissensfreiheit und vom Gottesgnadentum zur Demokratie führte[18]. Und dennoch wird bis heute festgehalten, dass die „Geburtsstunde“ der Demokratie eine Nähe zu der Glaubens- und Gewissensfreiheit aufweise, die Luther für sich und die Reformation ins Zentrum rückte.[19] Die Reformation Luthers hätte sich ohne den Schutz der Landesfürsten, die sich zum evangelischen Glauben bekannten, nicht dauerhaft halten können. Diese Verbindung hatte jedoch langfristig mehrere Folgen, insofern kirchlicherseits die Versuchung darin bestand, der Macht zu erliegen. Eine weitere Vermischung bestand in dem Versuch der Landesfürsten, die Reformation für ihre politischen Interessen zu nutzen.[20] Grundlegende Bedeutung für das Verhältnis zwischen Religion und Politik erhielt die Unterscheidung zwischen den „beiden Regimenten“. Mit dieser Differenzierung wurde sowohl das staatliche als auch das kirchliche Handeln in verschiedene Ebenen verwiesen, die nicht miteinander vermengt oder durcheinandergebracht werden sollen.[21] Weiterhin hat die Reformation erste Ansätze einer freiheitlichen Demokratie geschaffen. So hat sie sich zum Beispiel sowohl für die Freiheit und Verantwortung des Einzelnen eingesetzt als auch die Verantwortung der Christen für das Gemeinwesen betont. Parallel dazu vertritt Martin Luther die Position, dass die politische Macht eine gottgewollte Ordnung ist. Seine Überzeugung, dass der Mensch in einer Unmittelbarkeit zu Gott stehe und der damit verbundenen kritischen Ausführungen zur Institution Kirche und der Vermittlung des Heils durch die Kirche, hat er nicht für das Verhältnis der Untertanen gegenüber den Landesfürsten geltend gemacht. So konnte Luther kein Verständnis für die Bauern in ihrem Aufstand gegen die Fürsten aufbringen. Für ihn war es keine „theologisch zwingende Notwendigkeit“[22], dass die christliche Freiheit auch zu einer Freiheit in „politischen und sozialen Lebensverhältnissen“[23] drängt. Trotz seiner Kritik an der Amtsführung mancher Landesfürsten sah er sie als von Gott eingesetzt. Die Pflicht der Untertanen zum Gehorsam war ihm eine Selbstverständlichkeit.[24] Auch wenn Luthers Ethik keinen absoluten Gehorsam kannte, war es diese starke Betonung des Gehorsams, die noch lange in der lutherischen Ethik weiterwirkte. Luther war hier in seinem Denken in den Ansichten seiner Zeit gebunden. Er lebte in einer geschlossenen christlichen Gesellschaft und hatte eine christliche Obrigkeit im Blick. Luther und der Reformation gelang es im Fortgang des reformatorischen Aufbruchs auch nicht, die evangelischen Gemeinden in einer selbstständigen Kirchenform zu verbinden. Der Schutz der Landesherren war zu Beginn der Reformation von grundlegender Bedeutung, führte jedoch zu neuer Abhängigkeit von der staatlichen Gewalt bis zum Jahr 1918.[25]
2.2.1.3. Die nachreformatorische Zeit bis zur Weimarer Republik
Nach der Reformation entwickelte sich auch aufgrund der furchtbaren Glaubenskriege des 16. Und 17.Jahrhunderts zunehmend die Erkenntnis, dass es eine Friedensordnung nur geben könne, wenn zwischen Staat und Kirche eine Trennung vollzogen wird, weil nur so Glaubensvielfalt in einem Staat garantiert werden kann. Nur eine staatliche Gewalt, die ihre Legitimation nicht auf der Grundlage eines religiösen Anspruchs definiert, kann somit die Bedingungen für ein friedliches Zusammenleben verschiedener Konfessionen und Religionen schaffen.[26] Eine konsequente Trennung von Staat und Kirche erfolgte jedoch erst mit der französischen Revolution und mit der 1803 beginnende großen Säkularisierung.[27] Der Gedanke, dass ein säkularer Staat friedensbildend wirkt, wurde immer stärker unterstützt. Für die Kirchen bedeutete das, darauf zu verzichten, dass der Staat ihnen hinsichtlich ihrer religiösen Interessen Unterstützung zukommen ließ und damit auch kirchliche Macht in der Gesellschaft verloren ging.[28] Erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 war das Bündnis zwischen Staat und Kirche an ihr Ende gekommen, da die Monarchie in Deutschland durch die Weimarer Republik abgelöst wurde und somit ebenfalls der sogenannte Summepiskopat (dh. das staatskirchenrechtliche System, in dem der Landesherr als summus episcopus – oberster Bischof – bestimmte Rechte in der ihm untergeordneten Landeskirche innehatte) keine Grundlage mehr hatte. Das Volk war nun zum Souverän geworden, von dem alle Macht auszugehen hatte. Die Bürgerinnen und Bürger konnten zum ersten Mal aufgrund des allgemeinen Wahlrechts entscheiden, wer das Land regieren solle. Eine Zustimmung zur Demokratie seitens der Kirchen erfolgte formal erst mit dem Ende des Staatskirchentums im Jahre 1918. Die Evangelische Kirche musste nun ihre Kirchenverfassungen neu in eigener Verantwortung formulieren und gestalten. In manchen kirchlichen Verfassungen wurde die Kirchengewalt auf das Kirchenvolk übertragen.[29] Doch da es hier auch um Fragen von Macht und Einfluss ging, war dies längst nicht in allen kirchlichen Bereichen selbstverständlich. Das evangelische Bürgertum und die Pfarrerschaft stand der neuen Republik und damit auch der Demokratie vielfach dennoch skeptisch gegenüber, so dass ein neues Bündnis entstand, nämlich die Verbindung zwischen „Nation und Altar“[30],d.h. grundsätzlich ist festzustellen, dass das Denken im evangelischen Bereich noch in obrigkeitsstaatlichen Kategorien befangen war, was nicht zuletzt die Zustimmung zum autoritären Regime des Dritten Reichs im Jahre 1933 beförderte.[31] Auch viele der selbständigen Lutheraner in den Vorgängerkirchen der SELK erfüllte Skepsis gegenüber der Demokratie, da das Ende des Krieges und der Versailler Vertrag unter anderem als eine aufgezwungene Demütigung verstanden wurde.[32] In den selbständigen lutherischen Kirchen hielt man auch mit der Gründung der Weimarer Republik an einem Denken fest, dass zwischen Obrigkeit und Untertanen unterschied, obwohl die neue demokratische Ordnung eine andere Verhältnisbestimmung möglich gemacht hätte.[33] Volker Stolle stellt in seinem Werk „Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel des 19. Und 20.Jahrhunderts“ fest:
„So sehr die selbständigen lutherischen Kirchen an den ständestaatlichen Strukturen gehangen hatten, so schwer fiel es ihnen nun, sich mit der demokratischen Ordnung abzufinden. Sie entwickelten kein eigenes Konzept, wie sich lutherische Kirche innerhalb einer demokratischen Gesellschaft gestalten kann, obwohl sie sich auch im eigenen kirchlichen und gemeindlichen Bereich längst an demokratische Spielregeln gewöhnt hatten“[34]
Es hat den Anschein, dass die selbständigen lutherischen Kirchen die Demokratie ab 1919 mit ihren einschneidenden Veränderungen nicht weiter theologisch reflektiert haben, sondern sich hier dem damaligen „Zeitgeist“ unterordneten. Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass die Einführung des Frauenwahlrechts im Jahr 1919 zu keiner intensiven theologischen Debatte über die bisherige theologische Begründung geführt hat, in der behauptet wurde, dass die Frau gesellschaftlich dem Mann untergeordnet sei. Mit den demokratischen Veränderungen ging man pragmatisch um, ohne frühere biblische Begründungen kritisch zu diskutieren oder zurückzunehmen.[35] Diese Aufgabe, sich theologisch mit früheren Auslegungen und sich darauf gründenden kirchlichen Entscheidungen auseinanderzusetzen, die in späterer Zeit zurückgenommen oder aufgehoben werden, bleibt eine besondere Herausforderung. So kann gesagt werden, dass die Kirchen sich weithin nur zögernd auf die Staatsform der Demokratie eingelassen haben, obwohl sich die Demokratie „auf wichtige Motive des christlichen Glaubens stützen“[36] Es ist zu vermuten, dass es unter anderem deshalb zu einer Fremdheit der Kirchen gegenüber einer demokratischen Gesellschaftsform gekommen ist, weil die Weimarer Republik und danach ebenso die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg keine göttliche Legitimation beanspruchte, sondern sich allein auf den Willen des deutschen Volkes gründete. Die Theologie musste eine jahrhundertelange Denkfigur aufgeben, weil die Unterscheidung und Trennlinie zwischen „Obrigkeit“ und Volk/Untertanen durchlässig wurde, insofern in der Demokratie das Staatsvolk zum Souverän wird, von dem weltliche Macht ausgeht. Vor dem Zweiten Weltkrieg setzte die 5. These der Barmer Theologischen Erklärung einen Positionswechsel, weil der Staat „entmythologisiert“[37] wird. Das heißt, es ging den Autoren der Barmer Theologischen Erklärung nicht mehr um die Reflexion über das Wesen des Staates, sondern um seine Aufgabe, Recht und Frieden zu gewährleisten. Der Staat hat nicht das Recht, das Leben der Bürgerinnen und Bürger total zu bestimmen. Verantwortung haben beide, Regierende und Regierte.
2.2.1.4. Die Zeit nach 1945
Nach 1945 schlug aufgrund der Schreckensherrschaft Hitlers und seines todbringenden Regimes die Stimmung im Protestantismus um. Aus der früheren Staatsverherrlichung wurde eine Staatsverachtung, so dass der Staat nur noch als ein notwendiges Übel angesehen wurde. Die Kirche habe ein prophetisches Mandat, um den Staat auf dem richtigen Weg zu leiten.[38] Die Staatsform der Demokratie wurde aber nicht weiter reflektiert, weil sie als ein „weltlich Ding“ angesehen wurde.[39] Erst nach den beiden Weltkriegen im 20.Jahrhundert konnte die evangelische Kirche und Theologie ihr Verhältnis in einem längeren Prozess zur rechtsstaatlichen Demokratie korrigieren. Die grundlegende Denkschrift der EKD 1985 unter dem Titel „Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie“ war ein entscheidender Einschnitt. Die durch die Reformation „freigelegten Verantwortungsanteile und Traditionslinien“[40] wurden nun stärker gesehen und eingebracht. Die kirchliche und theologische Öffnung und Anerkennung der Demokratie hatte entscheidend mit der „Einsicht“ zu tun, dass die Menschenrechte für die rechtsstaatliche Demokratie eine grundlegende Bedeutung haben. Die Kirchen entdeckten, „dass sie in einer Demokratie, die an der Achtung der Menschenrechte und der Förderung des Friedens orientiert ist, ihrem eigenen Erbe begegnen“[41]. Heute betonen viele evangelische Theologinnen und Theologen eine innere Nähe und Affinität von Christentum und Demokratie. Sie wird folgendermaßen begründet: „(1) Der für das Grundgesetz entscheidende Gedanke der unantastbaren Menschenwürde ist im besten Sinne kompatibel mit dem biblischen Menschenbild. Dass die Menschen zum Bilde Gottes geschaffen sind, begründet aus christlicher Sicht ihre Würde als mit Vernunft begabte Geschöpfe Gottes. Auch die Tatsache der prinzipiellen Fehleranfälligkeit und Irrtumsfähigkeit des Menschen ist gut biblisch begründet und gehört ebenfalls zu den Prämissen der Demokratie. Eben deshalb braucht es begrenzte Amtszeiten für Leitungspersonen und regelmäßig stattfindende Wahlen. Schließlich ist der prinzipielle, unhintergehbare Pluralismus ein Kennzeichen des demokratischen Gemeinwesens, weil Menschsein und Pluralismus aufeinander bezogen sind: Demokratie ermöglicht und braucht den Pluralismus. Auch der christliche Glaube bejaht den innergesellschaftlichen Pluralismus. Die Kirche versteht sich selbst als »pluralismusfähig«, auch wenn sie in ihrer Mitte nicht von Pluralismus, sondern von Pluralität redet.[42] In diesen Ausführungen fehlt jedoch der Aspekt, dass die Kirche auch in der Demokratie ein kritisches Gegenüber zur Gesellschaft und Regierung zu bleiben hat. Die Kirche darf zwar nicht die Politik, die mit Vernunft nach sachlichen Lösungen für die Gesellschaft suchen muss, bevormunden. Jedoch bleibt für sie Gottes Willen und seine Gebote verbindlich, so dass sie ihre besondere christliche Sicht in die öffentliche Diskussion einbringen darf und soll.[43] Das schließt jedoch einen politischen Handlungsauftrag an die Kirche aus, was häufig übersehen wird.[44] Dieser kurze Durchgang zeigt, dass die Wirkungsgeschichte der Reformation in Bezug auf die Demokratieentwicklung keine gradlinige ist.[45]
3. Ein Blick in die SELK und ihre Verlautbarungen
In der Lebensordnung der SELK „Mit Christus leben“. Eine evangelisch-lutherische Wegweisung, aus dem Jahr 2009 findet sich ein Abschnitt „Christsein in Staat und Gesellschaft“. Dort wird zunächst grundsätzlich das Verhältnis von Staat und Kirche betrachtet und mit Bibelstellen untermauert.[46] Die demokratische Gesellschaftsordnung wird im Text nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch vorausgesetzt, in dem formuliert wird: „Lutherische Christen sollen sich für `der Stadt Bestes‘ einsetzen und darin nach Kräften mitarbeiten. Sie sind daher gerufen, wo möglich, selbst politische und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, und respektieren und unterstützen die staatlichen Ordnungen, die das Wohl aller im Auge haben. Dies beginnt mit der Wahrnehmung des Wahlrechts.“ [47] Hier wird die Demokratie als gegebene politische Ordnung selbstverständlich akzeptiert und unterstützt. Im gleichen Zusammenhang wird auf die Grundrechte aller Menschen Bezug genommen und festgestellt: „Christen sollen Andersdenkende nicht herabsetzen. Wo die biblisch begründeten Grundrechte von Menschen durch politische Entscheidungen oder von Einzelnen verletzt werden, ist es eine wichtige christliche Aufgabe, Zuflucht, Hilfe und Unterstützung anzubieten und zu leisten. Unter Umständen kann dies auch Widerstand gegen die staatliche Gewalt beinhalten.“[48] An diesen kurzen Textausschnitten wird erkennbar, dass Menschen- und Grundrechte sowie eine demokratische Gesellschaft mit Wahlrechten implizit positiv bewertet und zudem mit der Ausübung eines christlichen Lebenswandels verknüpft werden. Die Demokratie wird im Einklang mit den christlichen Werten wahrgenommen. Ein weiterer Text der SELK greift einen anderen Aspekt auf. Das Themenheft „Die Aufgabe der Kirche in der Entwicklungsarbeit“ aus dem Jahr 2006 konstatiert, dass der christliche Glaube im entwicklungspolitischen Engagement seine sichtbare Bewährung erfährt und formuliert selbstkritisch: „Der christliche Glaube und die Kirchen haben zwar die Gesellschaften und Staaten in mancher Beziehung geprägt und zur Herausstellung der Leitbilder von sozialer Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde beigetragen. Doch die biblische Botschaft ist in dieser Hinsicht häufig verdunkelt worden. Das Eintreten für Frieden, eine gerechte Ordnung und für gesicherte Menschenrechte hat sich oft von der Kirche getrennt, wurde außerhalb der Kirche überzeugender vertreten und ist oft eine Sache säkularer oder antikirchlicher Bewegungen. Dies anzuerkennen ist ein Gebot kritischer Einsicht.“[49] Der Kirche – und damit auch der SELK – wird hier ein Defizit bescheinigt, nämlich zu wenig politisch aktiv sich für die ethischen Aspekte des Glaubens in der Gesellschaft eingesetzt zu haben. Zu fragen wäre, wie es dazu kommen konnte, welche Hintergründe dazu geführt haben und was zu tun wäre, um solche Defizite früher zu erkennen und zu beheben. Im Themenheft wird formuliert, dass die SELK ihr entwicklungspolitisches Engagement verwirklicht, indem sie „• die Erkenntnis in der eigenen Kirche fördert, die Notwendigkeit zur Verbesserung von Lebensbedingungen anderer zu sehen, das Evangelium sichtbar macht durch praktische Hilfen für Menschen in Not, Armut, Krieg, Katastrophen, d.h. für ganzheitlichen Beistand durch Wort und Tat eintritt, sich am Aufbau einer Gesellschaft beteiligt, in der alle Menschen unabhängig von Rasse und Geschlecht als Geschöpfe Gottes anerkannt und geachtet werden…“ In einem weiteren Text der Ethikkommission der SELK zur Wirtschaftsethik aus dem Jahr 2008 wird im Kontext der sozialen Gerechtigkeit formuliert: „Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen und so mit einer unveräußerlichen Würde ausgestattet.“[50] Die Professoren der Lutherischen Theologischen Hochschule haben in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Volkshochschule Hochtaunus im Wintersemester 2016/2017 Vorträge zur Verhältnisbestimmung von Religion und Politik gehalten und sich ebenfalls mit der Thematik des heutigen Tages befasst. Werner Klän formuliert in seinem Vortrag: „Eine ‚neutrale Haltung‘ gegenüber dem Staat und gesellschaftlichen Entwicklungen ist jedenfalls keine mögliche Haltung für Christen. So ist es die Aufgabe der Kirche, den Staat bei Menschenrechtsverletzungen offen auf Gottes Gesetz hinzuweisen und sein Gericht anzusagen.“[51] Daneben finden sich weitere Beispiele aus dem kirchlichen Alltag der SELK, wo über Menschenrechte, Demokratie und Hass gegenüber Muslimen und einem Antisemitismus diskutiert und extreme Positionen deutlich abgelehnt werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die evangelische Kirche vor langer Zeit ihre skeptische Haltung gegenüber der Demokratie korrigiert und sogar die Fortentwicklung von Demokratie und Zivilgesellschaft unterstützt hat.“[52] Ich denke, diese Aussagen gelten in gewisser Weise auch für die SELK und ihren Verlautbarungen. Es wäre interessant, das offizielle Organ der SELK, Lutherische Kirche, daraufhin zu untersuchen, wie und in welcher Form das Thema „Demokratie“ bearbeitet wird. Neben dieser eher positiven Haltung der Kirchen zu Demokratie gibt es seit Jahren eine deutliche Gegenbewegung, die auch vor den Kirchen nicht Halt macht. Dazu nun ein nächster Schritt.
4. Ein Blick in die Wirklichkeit heutiger Diskurse in Kirchen und unter Christen zur Demokratie
Weltweit wurden Demokratien werden angegriffen und destabilisiert. Immer heftiger artikulieren Menschen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Politik und den sogenannten Qualitätsmedien. Polarisierungen und sogenannte fundamentalistische Strömungen in säkularen und religiösen Gemeinschaften nehmen zu. Dieser Prozess hat mit der Entstehung der AFD im Jahr 2013 und ihrer Radikalisierung ab 2015 Fahrt aufgenommen.[53] Auch Christen aus vielen Kirchen beteiligen sich daran und fordern eine andere Demokratie als die real existierende in Deutschland. Bis etwa 2013 gab es am sogenannten rechtskonservativen Rand der Anhängerschaft von CDU und CSU Christen, die jedenfalls gesellschaftspolitisch eine deutliche Nähe zu Haltungen und Positionen von AFD Anhängerinnen und Anhängern vertraten. Lange Zeit jedoch wurden sie nicht intensiver von der Öffentlichkeit wahrgenommen. So fiel zum Beispiel nicht weiter auf, dass Christinnen und Christen aus verschiedenen Kirchen bereits das 2010 erschienene Buch „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin auf publizistischer Ebene oder in sozialen Medien verteidigt hatten und damit ihre Kritik an demokratischen Werten zum Ausdruck gebracht haben.[54] Eine Spaltung des sogenannten konservativen christlichen Milieus vollzog sich im Jahr 2013, da im Frühjahr des Jahres 2013 die AFD gegründet wurde. Ab diesem Zeitpunkt stellen viele Beobachterinnen und Beobachter der politischen Auseinandersetzungen eine Bruchlinie innerhalb der christlich konservativen Milieus fest. Es wurde deutlicher erkennbar, dass sich konservative christliche Kreise zum einen in eine moderat konservative Richtung und zum anderen in eine für „rechte Gedankenwelten“ offene Gruppe auseinanderentwickelten.[55] Im Jahr 2015 beschreibt der katholische Publizist Andreas Püttmann in der „ZEIT“Beilage „Christ & Welt“ die hier angesprochene rechte Gesinnung: „In einem Zeitraum von kaum zwei Jahren schieden sich die Geister in eine moderat konservative und eine radikal rechtskonservative Strömung, in welcher vordemokratische und vorkonziliare Denkmuster – ‚Keine Freiheit für den Irrtum!‘ – aufscheinen. Sie ähneln ideologisch der russischen Orthodoxie und der ‚konservativen Revolution‘ der Weimarer Zeit: Völkisch, nationalistisch, antiliberal ordnungsfixiert, parteien- und medienverdrossen, antiwestlich (speziell antiamerikanisch), von Ressentiments gegen Minderheiten und von Untergangsfantasien erfüllt, eine ‚Identität‘ von Religion, Kultur und Nation, Regierung und Volk erstrebend.“[56] So ist es in den Kirchen zu tiefen Konflikten zwischen Christen gekommen, die sich moderat konservativ äußerten und eine maßvolle Kritik an der modernen Gesellschaft unterstützten und anderen Christen, die darüber hinaus mit weitergehender Kritik und vor allem im Ton mit schärferen Angriffen auf den Niedergang der Moral und der Demokratie reagierten. Häufig wurde in diesem Kontext die sogenannte politische Korrektheit angegriffen und der Slogan benutzt: „Das darf man doch wohl noch sagen.“[57] Ganz ähnliche Phänomene finden sich in anderen Gesellschaften. Arnd Henze blickt in seinem Buch: „Kann Kirche Demokratie“, dass im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, auf die Vorgänge in den USA und dem früheren Präsidenten Donald Trump, der demokratische Regeln und Grundsätze immer wieder für sich selbst nicht als bindend akzeptiert hat: „Wie erklärt sich diese unheilige Allianz treuer Kirchengänger mit einem mehrfach verheirateten Milliardär, der seinen Reichtum vor allem mit Casinos aufgebaut hat, der schon im Wahlkampf mit üblem Sexismus Schlagzeilen machte, mit allen Mitteln versuchte, eine Affäre mit einer Prostituierten zu vertuschen und einen Juristen ans Oberste Gericht brachte, dem sogar Vergewaltigung vorgeworfen wurde? …Man findet unter evangelikalen Wortführern wohl niemanden, der versuchen würde, Trumps persönliche Lebensführung und seine brachiale Rhetorik zu rechtfertigen. Sie werden in Kauf genommen, weil es Prioritäten gibt, die für die Evangelikalen alles andere überragen. Diese Prioritäten betreffen nicht nur harte Interessen, sondern vor allem Fragen kultureller Hegemonie.“[58] War zwischenzeitlich klar, dass Demokratie viele christliche Werte unterstützt, schien dies nun nachrangig gegenüber dem Wunsch, den kirchlichen Einfluss in der Gesellschaft zu vergrößern. Kirche als ein Ort der Distanzierung gegenüber politischer Äußerungen und damit Korrektur wurde in diesen Kreisen nicht gewollt. Soweit ich mich informieren konnte, finden sich auch in der größten Schwesterkirche der SELK, der Lutheran Church Missoury-Synod in den USA viele Unterstützer und Unterstützerinnen Donald Trumps.. Innerhalb der Kirchen verlaufen Streitlinien zwischen Christen, die die Rückkehr konservativer Regierungen zu christlichen Werten unterschiedlich bewerten. Das Gegeneinander und Unverständnis füreinander zwischen den Christen, die sich gegen eine aus ihrer Perspektive rechte Gesinnung stellen und denen, die sehr bewusst aus ihrem Blickwinkel dem Zeitgeist und dem Mainstream der Gesellschaft Widerstand entgegensetzen, ist nicht mehr zu übersehen. Das wird zum Beispiel an der Rückkehr zu einer restriktiven Abtreibungsgesetzgebung in manchen Ländern, an dem Thema „Einwanderung, Integration und Asyl“ oder der Genderthematik erkennbar. Sogenannte „rechte“ Christen sind in der Corona-Pandemie verstärkt mit Protesten gegen Anti-Corona-Maßnahmen aufgetreten. Sie kritisierten die ihrer Meinung nach „totalitären“ Eingriffe des Staates und die „Meinungsdiktatur“ der sogenannten „Mainstreammedien“, die ihre Unabhängigkeit verloren hätten. Auch wenn diese Kritik zum Teil anders als in rechtspopulistischen Bewegungen motiviert war und ist, zeigen sie deutliche Übereinstimmungen. Dabei muss jedoch davor gewarnt werden, dass politische und christliche Kritik an der Corona-Politik oder den Medien nicht automatisch eine „rechte Gesinnung“ impliziert. Diese Auseinandersetzung ist unübersichtlich geworden, weil fast immer die formulierte Kritik auch Punkte benennt, die mit Recht zu kritisieren sind, die aber im demokratischen Diskurs auch ihren Raum bekommen. Exemplarisch für eine sich auf das Christentum berufene rechtsorientierte und regierungskritische Haltung konnte man im November 2020 auf einer Berliner Demonstration sehen, in der eine junge Frau vor einem Polizisten steht und ihm ein Kruzifix entgegenhält.[59] An dieser Szene zeigt sich meines Erachtens eine Angst vor einer gottfeindlichen Gesellschaft, vor der man sich schützen muss. Der wissenschaftliche Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Martin Fritz, unterscheidet konservatives und rechtes Christentum folgendermaßen: „Rechtes Christentum ist christlicher Konservatismus im Kulturkampfmodus. Seine mentale Grundeinstellung ist konservativ. Aber dazu kommt das depressive Bewusstsein, mit den betreffenden Anliegen im Zuge der gesellschaftlichen Liberalisierungsschübe seit den 1960er Jahren kulturell massiv ins Hintertreffen geraten zu sein.“[60] Infolgedessen sei ein weiteres Merkmal rechter Christen „die aggressive Entschlossenheit zur religiös-kulturellen Gegenoffensive“[61]. So sei rechtes Christentum „konservatives Christentum in populistischer Verschärfung.“[62] Diese These ist es wert, weiter diskutiert zu werden. Soweit ich die gegenwärtige Lage im Christentum wahrnehme, verschwimmen die Übergänge zwischen einem konservativen und einem rechten Christentum, so dass es nicht immer möglich ist, einzelne Positionen der einen oder anderen Bewegung zuzuordnen. Ich nehme jedoch eine Diskrepanz zwischen den im Vortrag beschriebenen wohlwollenden Verlautbarungen der Kirchen zur Demokratie und der Ablehnung einer demokratischen Gesellschaft wahr, in der christliche Überzeugungen verloren gehen und der Niedergang der Gesellschaft erwartet wird. Die hier beschriebenen Konflikte in den modernen westlichen Demokratien sind nur ein Ausschnitt dem größeren Themenfeld „Fundamentalismus“, das die Politik und Religion seit Jahrzehnten bewegt. Im Jahr 2018 vor den Auseinandersetzungen, die mit der Corona-Pandemie weltweit entstanden, stellt der Theologe und Chefredakteur von Publik Forum Alexander Schwabe fest: „Gotteskrieger, Glaubensfanatiker, Eiferer: Ob hinduistische, muslimische, christliche oder jüdische Extremisten, alle meinen sie, für eine gerechte Sache, die richtige Sache, die richtige Seite, die eine Wahrheit zu streiten. Heilig, wofür sie in den Kampf ziehen… Jene, die einfache Wahrheiten gegen noch so durchschlagende Argumente verteidigen; jene, die immer und überall Verschwörungen beschwören, um sich der komplexen Wirklichkeit nicht stellen zu müssen. Jene, die an eine bestimmte Ideologie glauben und nichts neben ihr stehen lassen. Es mag gravierende Unterschiede in den Methoden geben und im Ausmaß der Militanz – doch alle diese ideologisch motivierten Kräfte verbindet etwas: das fundamentalistische Denken. Und: Religiöse wie säkulare Fundamentalisten vereint der Kampf gegen denselben Feind: die offene, liberale Gesellschaft.“[63] Zugegeben – das sind sehr extreme Positionen. Aber sie finden sich in verschiedenen Ansätzen und in unterschiedlicher Gewichtung in vielen Kirchen.[64] Fundamente für das eigene Leben zu haben, ist wichtig und sinnvoll. Es schafft im Leben Stabilität. In der postmodernen Welt sind jedoch auch für viele Christen die eigenen Fundamente erschüttert worden, so dass eine Verunsicherung und Abwehr entsteht. Damit verbunden sind häufig Ängste und die Suche nach einem neuen stabileren Fundament. Auch das ist verständlich und braucht das Gespräch. Mit der Demokratie ist die gerade beschriebene extreme Form der Absicherung des eigenen Fundaments nicht zu vereinbaren, da es in ihr um das Aushalten verschiedener Meinungen und Positionen (Pluralität), um den positiven Streit um den richtigen Weg einer Gesellschaft, um Freiheit und um Gerechtigkeit geht.[65]
Ausblick
Auf dem Podium der Jubiläumsveranstaltung der SELK zur 50jährigen Gründung der SELK in Oberursel entfaltete Professor Dr. Barnbrock folgende These, die sich an diese Wirklichkeit anschießt und meines Erachtens auch für unsere Kirche bescheinigt, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Demokratie nach jahrelanger Ruhe wieder in Frage steht. Er formuliert seine vierte These folgendermaßen: „Weiterhin wird die SELK in der Zukunft mehr als jetzt vor der Aufgabe stehen, ihr Verhältnis zu einer demokratischen, nachaufklärerischen, zunehmend nicht mehr christlich geprägten Gesellschaft zu definieren.“[66] In der Erläuterung dieser These fragt Barnbrock, welche universalen Werte, wie zum Beispiel die Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit die SELK unbedingt teilt und wie sich diese Werte zu den spezifisch christlichen Werten verhalten, an die sich die SELK gebunden weiß?[67] Daran anknüpfend habe ich den Eindruck, dass es in der SELK und ebenso in anderen Kirchen ein großes Bedürfnis nach Klarheit und Orientierung gibt und sich die oben angesprochene Spaltungstendenz zwischen einer moderaten konservativen Ausrichtung und einer eher „rechten“ Gesinnung mit einer Nähe zu AFD – Positionen verstärkt. Diese Polarisierung innerhalb der Kirchen wird in der SELK unter anderem in den Debatten deutlich, die in den Leserbriefen der Publikation „Lutherische Kirche“ zu finden sind. Nicht selten nehme ich Texte der Briefschreiberinnen und Schreiber als scharfe Angriffe wahr, die die gegenteilige Position radikal negiert. Es geht soweit ich diese Debatten verstehe, auch darum, Gott gehorsam zu sein und sich energisch anderen Zeitströmungen zu widersetzen. Es geht um den Gehorsam gegenüber Gott und seinem Willen, der möglichst im Alltag umzusetzen ist, weil in heutiger Zeit alle Fundamente brüchig geworden seien. Wenn es jedoch zu einer Überbetonung des Gehorsams kommt, erinnert das an die vordemokratische Zeit, in der es nur Untertanen und Herrscher gegeben hat. Die Gefahr besteht darin, dass damit das Ringen und der Streit um den richtigen Weg in einer Gesellschaft und ebenso in der Kirche letztlich verkürzt oder erstickt wird. Eine konkrete Situation, die ich beschreibe, soll das verdeutlichen: Ein leitender Theologe hält bei einer Konferenz der Mitarbeitenden einer Beratungsarbeit der Kirche einen Vortrag. Sein Ton und sein Inhalt, sein Auftreten und seine Gesten waren darauf gerichtet, das selbständige Denken der Zuhörenden zu unterdrücken, was den Glauben betrifft. Es ging weniger um Argumente als um Gehorsam. Als Zuhörer gefragt wurden, wie sie den Vortrag fanden, hörte man häufig nur Positives. Es scheint so zu sein, dass wir Menschen mehr als wir wahrhaben wollen, nach einem autoritären Halt suchen. Der autoritäre Vortrag vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Etwas überspitzt könnte man formulieren: Ein strenger Glaube und der Gehorsam befreien so von der lästigen Notwendigkeit, selbst weiter zu denken, zu fragen und Unsicherheiten im Urteil auszuhalten.[68] Demokratie ist jedoch nicht zu verwirklichen ohne ein Vertrauen in den Menschen und seinen Verstand.[69]
Nicht zuletzt weist schon das Grundbekenntnis der Reformation, die Augsburger Konfession darauf hin, dass es möglich und wichtig ist, sogenannte weltliche und politische Fragen mit Einsicht, Vernunft und dem freien Willen zu klären. So formuliert der 16. Artikel: „ ….das Evangelium schafft weltliche Regierungsgewalt, Staatsordnung und Ehestand nicht ab, sondern will, dass man dies alles als wahrhaftige Ordnungen Gottes anerkennt und in diesen Lebensbereichen christliche Liebe erweist und rechte, gute Werke tut, jeder in seinem Verantwortungsbereich, in den er berufen ist.“[70] Und im 18. Artikel der Augsburger Konfession wird darauf hingewiesen, dass der Mensch einen freien Willen habe. Er kann „äußerlich ein ordentliches Leben führen und in Angelegenheiten, die der Vernunft zugänglich sind, frei entscheiden.“[71] Es könnte sein, dass die Reformation aufgrund ihrer Betonung, dass der Mensch Sünder ist, die Vernunft als Gabe Gottes nicht mehr ausreichend würdigen konnte. Von der Sündhaftigkeit des Menschen ist es kein großer Schritt mehr, grundsätzlich den Menschen als unzuverlässig und verdorben zu beurteilen. Und wenn das so ist, dann brauchen Menschen sowohl in der Kirche als auch in der Politik starke Führung und Bestrafung bei Ungehorsam.[72] Die westlich orientierten demokratischen Gesellschaften setzten genau diesen freien Willen voraus und ebenso den Rückgriff auf die Vernunft. Aber mit diesem freien Willen und der Vernunft entstehen folgerichtig demokratische Aushandlungsprozesse, die Konflikte einschließen und unerlässlich sind. In der schon erwähnten Denkschrift der EKD: Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetztes als Angebot und Aufgabe, aus dem Jahr 1985 heißt es folgerichtig: „Eine demokratische Gesellschaft muss konfliktfähig sein. Konflikte dürfen nicht verdrängt und unterdrückt werden; sie müssen öffentlich ausgetragen werden. Öffentlicher Konfliktaustrag erfordert aber, dass die Auseinandersetzungen sachlich geführt werden und dass die Konfliktpartner sich am Ziel eines Konsenses oder eines Kompromisses orientieren.“[73] Man könnte dieses Zitat auch auf die Kirche anwenden und sagen: Eine Kirche muss konfliktfähig sein. Konflikte dürfen nicht verdrängt und unterdrückt werden; sie müssen ausgetragen werden. Konfliktaustrag erfordert aber, dass die Auseinandersetzungen sachlich geführt werden und dass die Konfliktpartner sich am Ziel eines Konsenses oder eines Kompromisses orientieren. Um so miteinander in einer Kirche zu leben und zu streiten, gibt es die Strukturen von der Grundordnung der Kirche über die Gemeindeversammlungen und Bezirkssynoden und – Konvente bis hin zum Allgemeinen Pfarrkonvent und der Kirchensynode. Ohne diese partizipatorischen Strukturen würde der Rahmen für eine angemessene Konfliktkultur in der Kirche fehlen. Dennoch ist mit den Strukturen noch nicht unbedingt gesetzt, dass in der Kirche eine innerkirchliche „Demokratie“, d.h. eine synodale Struktur breite Unterstützung erhält oder mit Leben gefüllt wird. Daneben braucht es meines Erachtens weitere konstruktive Debatten, die sich an die Beobachtung von Prof. Dr. Barnbrock anschießen. Konflikte und Polarisierungen in der Kirche bleiben der SELK erhalten, weil bisher keine Antwort auf die Frage gefunden wurde, welche universalen Werte, wie zum Beispiel die Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit die SELK unbedingt teilt und wie sich diese Werte zu den spezifisch christlichen Werten verhalten, an die sich die SELK gebunden weiß?[74] Daneben stehen weitere Fragen, die in der Kirche für Diskussion sorgen, so zum Beispiel die Frage nach einer angemessenen Vielfalt und der notwendigen Einheit im Glauben und Bekennen. Prof. Dr. Christian Neddens fragt meines Erachtens mit Recht in seinem Vortrag „Good News in a Fake news world“ „Wie vermitteln wir die wünschenswerte Einmütigkeit im Bekenntnis mit der vorhandenen Vielfalt menschlicher Erfahrung – im Blick auf das Miteinander in den Gemeinden, aber auch im Blick auf unser Selbstverständnis innerhalb der Ökumene?“[75] So braucht die Kirche meines Erachtens in dieser Zeit der Polarisierungen eine Haltung des gegenseitigen Aushaltens und der Toleranz. Toleranz heißt zu ertragen, was nur schwer zu ertragen ist, den Anderen, das Fremde, das normativ Abgelehnte auf der Grundlage einer fundamentaleren Akzeptanz. Toleranz schließt Kritik nicht aus. Sie muss auch Grenzen des Tolerierbaren ziehen. Gefragt ist mehr denn je die Debatte mit einer klaren Trennung zwischen Person und Äußerung. Persönliche Herabsetzungen und Pauschalurteile verschärfen die Debatte. Geduld und Höflichkeit, die Einsicht in die eigenen Grenzen der Erkenntnis und die Bitte um Gottes Geist helfen im Streitgespräch. Wir benötigen Raum für offene Debatten, in denen Sorgen, Ängste und Probleme benannt, Lösungsvorschläge diskutiert und am Evangelium überprüft werden können.[76]
[1] David Jordahl, Die zehn Ängste der Kirche, Stuttgart 1993. Dr.David Jordahl.wurde in den USA 1934 geboren leitete seit 1971 die Psychologische Beratungsarbeit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Er studierte Theologie in Kalifornien, Theologie und Psychologie in Bonn und Wien. Seine Analytiker – Ausbildung absolvierte er am C.G.Jung – Institut in Zürich. Promoviert wurde Jordahl 1987 in Marburg.
[2] Martin Honecker, Demokratie als Lebensform, in Deutsches Pfarrerblatt, 9/2013, 1
[3] A.a.O, 6
[4] Harald Welzer, Macht gegen Macht. Die Freunde einer offenen Gesellschaft müssen klüger agieren, in Zeitzeichen
2/2017, 8
[5] So sind zum Beispiel Pfarrer der SELK in der Initiative „Kirche für Demokratie – gegen Rechtsextremismus“ aktiv, die sich vor allem für den Schutz der Demokratie vor radikalen Tendenzen einsetzt. Vgl. dazu den Text unter selk-aktuell vom 20.02.2016 unter dem Titel „Für Demokratie – gegen Rechtsextremismus“; https://www.selk.de/index.php/2016/2016–februar/324–fuer–demokratie–gegen–rechtsextremismus. Weitere Informationen unter: https://www.kirchliche–dienste.de/arbeitsfelder/ikdr/Ueber–uns
[6] Charta Oecumenica, 13, abzurufen unter: https://www.oekumene–
ack.de/fileadmin/user_upload/Charta_Oecumenica/Gemeinsamer_Weg_mit_der_Charta_Oecumenica.pdf
[7] Helmut Schmidt, in: Evangelische Kommentare, Nr 4, 1981, Politik und Geist, 209f – ich zitiere aus diesem Interview aus: Veröffentlichungen der Luther-Akademie Ratzeburg, Band 5, Autorität des kirchlichen Amtes und der synodalen Konsensusbildung im Zeitalter der Demokratie, Erlangen, 1983, 129f 8 A.a.O. 130
[8] A.a.O. 130
[9] Zitiert aus: Zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Januar 2017, Georg Kalinna, Einhegung der Sünde. Was aus evangelischer Sicht für die Demokratie spricht, unter:
https://zeitzeichen.net/index.php/archiv/2017_Januar_protestantismus–und–demokratie abzurufen.
[10] Wilfried Loth, ein deutscher Historiker und Politikwissenschaftler, formuliert in einem Aufsatz „Katholizismus und Demokratie in Europa“ in: Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte, abzurufen unter: https://theologiegeschichte.de/ojs2/index.php/tg/article/view/473/512 „Erst Papst Johannes XXIII. bekannte sich ausdrücklich zum Gleichheitsprinzip und zu seinen politisch-sozialen Konsequenzen. In der Enzyklika Pacem in terris erklärte er, dass „alle Menschen in der Würde ihrer Natur gleich sind“, und zog daraus weitreichende staats- und gesellschaftspolitische Konsequenzen: die Forderung nach Unverletzlichkeit der Grund- und Menschenrechte, insbesondere des Rechtes auf soziale Sicherheit, die Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau, Beseitigung von Rassendiskriminierungen, Schutz nationaler Minderheiten und Hilfe für Entwicklungsländer. Die Menschenrechte schlossen für ihn das „Recht auf Irrtum“ ein; damit bekannte er sich implizit auch zum Recht auf Religionsfreiheit und zum Prinzip der Toleranz.“
[11] Vgl. dazu Arnd Henze, Kann Kirche Demokratie, Freiburg, 2019: „Wie erklärt sich diese unheilige Allianz treuer Kirchengänger mit einem mehrfach verheirateten Milliardär, der seinen Reichtum vor allem mit Casinos aufgebaut hat, der schon im Wahlkampf mit üblem Sexismus Schlagzeilen machte, mit allen Mitteln versuchte, eine Affäre mit einer Prostituierten zu vertuschen und einen Juristen ans Oberste Gericht brachte, dem sogar Vergewaltigung vorgeworfen wurde? …Man findet unter evangelikalen Wortführern wohl niemanden, der versuchen würde, Trumps persönliche Lebensführung und seine brachiale Rhetorik zu rechtfertigen. Sie werden in Kauf genommen, weil es Prioritäten gibt, die für die Evangelikalen alles andere überragen. Diese Prioritäten betreffen nicht nur harte Interessen, sondern vor allem Fragen kultureller Hegemonie.“ 28-29
[12] Vgl. Arnd Henze, Kann Kirche Demokratie, Freiburg, 2019, 35-36
[13] Volker Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel des 19. Und 20.Jahrhunderts. Aus der Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, Göttingen, 2019, 228
[14] Vgl. Jorg Christian Salzmann, „…ein ruhiges und stilles Leben führen“? – Politik und Religion nach dem Neuen
Testament, in:Politik und Religion, Oberurseler Hefte 56, hg. von Achim Behrens, Oberursel 2018, 37-38
[15] Ebd.
[16] Lutherbibel 2017, Galater 3,26-28
[17] Eine kurze Zusammenfassung zum Thema „Luther und die Politik“ gibt Albert Greiner, Luther und das Politische, in:
Lutherische Kirche in der Welt, hg. von Ernst Eberhard, Folge 32, 1985, 39-53; Außerdem: Werner Klän, Das Evangelium löst den Staat und die Wirtschaft nicht auf, in: Oberurseler Hefte 56, Politik und Religion, hg. von Achim Behrens, 2018,61ff
[18] Reinhold Zippelius, Staat und Kirche, Eine Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart, München, 1997, 114
[19] Ebd.
[20] Vgl. Hans-Jürgen Papier, Rechtsstaatliche Demokratie, in: Von Arbeit bis Zivilgesellschaft. Zur Wirkungsgeschichte der Reformation, hg. Von Gerhard Wegner, 2017, 250
[21] CA 28: „Denn die weltliche Gewalt geht mit völlig anderen Dingen um als das Evangelium. Sie schützt nicht die Seele, sondern Leib und Gut durch das Schwert … Darum soll man die beiden Herrschaftsweisen, die geistliche und die weltliche nicht miteinander vermengen….“
[22] Martin Hoffmann, Studienbuch Martin Luther. Grundtexte und Deutungen, 2014, 232
[23] Ebd.
[24] Vgl. Georg Kalinna, Einhegung der Sünde. Was aus evangelischer Sicht für die Demokratie spricht, in: Zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Januar 2017, siehe: https://zeitzeichen.net/index.php/archiv/2017_Januar_protestantismus–und–demokratie
Außerdem formuliert Martin Honecker in seinem Aufsatz: „Demokratie als Lebensform Die evangelische Kirche in Deutschland und ihre Einstellung zur politischen Kultur“, erschienen im Deutschen Pfarrerblatt, Ausgabe 9/2013 unter der Überschrift „Obrigkeitsstaatliche Hypothek“: „Zunächst ist eine historische Erinnerung angebracht. Denn das evangelische Verständnis des Staates und des Verhältnisses von Staat und Kirche ist durch eine geschichtliche Hypothek belastet. Seit dem 16. Jh. waren evangelisch gewordene Staaten Obrigkeitsstaaten, wie übrigens auch in Deutschland katholische Territorialstaaten – sieht man von geistlichen Fürstentümern und Herrschaften ab. In evangelischen Staaten wurde die obrigkeitsstaatliche Orientierung überdies unterstützt und verstärkt durch das landesherrliche Kirchenregiment. Der Landesherr war zugleich summus episcopus. Er fiel daher auch unter den
Geltungsanspruch des vierten Gebotes. Die Obrigkeit wurde patriarchalisch verstanden.“
[25] Vgl. Martin Hofmann, Studienbuch (wie Anmerkung 16), 232
[26] Vgl. Hans-Jürgen Papier, Rechtsstaatliche Demokratie (wie Anm. 14), 251
[27] Ebd.
[28] Ebd.
[29] Vgl. Martin Honecker, Demokratie, (vgl.Anm.2)
[30] Ebd., Einer der weitsichtigen lutherischen Theologen der Zeit zwischen den Weltkriegen war Hermann Sasse, der im Kirchlichen Jahrbuch 1931 formuliert, dass sich der „Glaube an das Volk und Volkstum“ christlicher Begriffe bediene und so die Kirche in den Dienst seiner weltlichen Zwecke stelle. Sasse: „Hier liegt das theologische Problem der nationalen Bewegung“. Siehe: Christian Neddens, Theologische Gegenwartsdeutung in „Weimarer Republik“ und „Drittem Reich“, in: Werner Klän, Der Theologe Hermann Sasse (1895-1976), Göttingen 2020, 92
[31] Ebd.
[32] Volker Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel des 19. Und 20.Jahrhunderts. Aus der Geschichte selbstständiger evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland, Göttingen, 2019, 228
[33] Vgl.a.a.O., 231
[34] A.a.O., 232
[35] Vgl. dazu Volker Stolle, Die Bedeutung der Weimarer Reichsverfassung von 1919 für die selbständigen evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland, in Lutherische Theologie und Kirche, 43.Jg 2019, 85
[36] Wolfgang Huber, in: Den Glauben verstehen, Ein evangelischer Glaubenskurs in 50 Kapiteln, Berlin, 2012, 77
[37] Vgl. Martin Honecker, Demokratie, (vgl.Anm.2)
[38] Ebd.
[39] Nicht zuletzt tat sich der Protestantismus mit einer theologischen Einordnung der Demokratie auch deshalb schwer, weil zum einen für die Bekenntnisschriften der Reformationszeit eine Demokratie nicht zur Diskussion stand und zum anderen selbst die Barmer Theologische Erklärung 1934 die Frage nach dem Verhältnis der evangelischen Kirche zur Demokratie nicht beantwortet hat.
[40] A.a.O. Hans-Jürgen Papier, 250-251
[41] Wolfgang Huber, in: Den Glauben verstehen, Ein evangelischer Glaubenskurs in 50 Kapiteln, Berlin, 2012,77
[42] Eberhard Pausch, Demokratie innerhalb der Kirche? Zehn Thesen, erschienen im Deutschen Pfarrerblatt, Ausgabe
9/2013, 14
[43] Vgl. dazu Werner Klän, Das Evangelium löst den Staat und die Wirtschaft nicht auf, in: Oberurseler Hefte 56, Politik und Religion, hg. von Achim Behrens, 2018,74f
[44] A.a.O., 73
[45] A.a.O., Hans-Jürgen Papier, 251
[46] Die Belegstellen sind folgende: Jeremia 29,7; Römer 13,1-2+7; 2 Mose 22,20, Apg. 5,29
[47] Mit Christus leben. Eine evangelisch-lutherische Wegweisung, Lutherische Orientierung 6, 35
[48] Ebd.
[49] Die Aufgabe der Kirche in der Entwicklungszusammenarbeit, hg. vom Arbeitskreis der SELK für Kirchlichen Entwicklungsdienst, Lutherische Orientierung 3, 15
[50] „Haben als hätten wir nicht“. Wirtschaftethik in verantworteter Freiheit, Themenhefte der SELK, Lutherische
Orientierung 7, 23
[51] Werner Klän, Das Evangelium löst den Staat oder die Wirtschaft nicht auf“, in Oberurseler Hefte.Studien und Beiträge für Theologie und Gemeinde, Heft 56, Oberursel, 74
[52] Vgl. EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, zitiert aus: Georg Kalinna, Einhegung der Sünde. Was aus evangelischer Sicht für die Demokratie spricht, in: Zeitzeichen, Januar 2017 https://zeitzeichen.net/archiv/2017_Januar_protestantismus–und–demokratie
[53] Vgl. Liane Bednarz, Die Angstprediger Wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern, München 2018, 13; Liane Bednarz formuliert im EZW-Text 256, „Rechtspopulismus und christlicher Glaube“ unter dem Titel: „Christen in der AFD“: „Mit der Alternative für Deutschland (AfD) ist es in der Geschichte der Bundesrepublik erstmalig einer rechtsgerichteten Partei gelungen, sowohl in den Bundestag als auch in mittlerweile fast alle Landesparlamente einzuziehen. Schaut man sich das Personaltableau an, so fällt auf, dass sich unter den Mandatsträgern und Funktionären der AfD auch bekennende Christen finden. Mit der Gruppierung „Christen in der AfD“ („ChrAfD“ = gesprochen „Kraft“) gibt es sogar einen organisatorisch verfestigen Zusammenschluss von Gläubigen innerhalb der Partei.“,
[54] Vgl. Liane Bednarz, Christen in der AFD, in: EZW-Text 256, Rechtspopulismus und christlicher Glaube, Berlin, 25
[55] A.a.O., 26 Liane Bednarz formuliert: „Bei den Katholiken waren und sind davon vor allem traditionalistische, aber auch klassisch konservative Milieus betroffen. Im protestantischen Bereich ist das Ganze vor allem in evangelikalen Milieus in und außerhalb der Landeskirchen zu beobachten.
[56] A.a.O., 26-27
[57] A.a.O., 27
[58] Arnd Henze, Kann Kirche Demokratie, Freiburg, 2019, 28-29
[59] Vgl. Martin Fritz. Im Bann der Dekadenz, Theologische Grundmotive der christlichen Rechen in Deutschland, EZW Texte 273, 2021, Berlin, 3
[60] A.a.O., 88
[61] Ebd.
[62] Ebd.
[63] Alexander Schwabe, Die bunte Welt hinter den Buchstaben. Die Demokratie ist bedroht. Wie sich Leserinnen und
Leser gegen fundamentalistischen Denken wappnen können. Ein Essay, in: Publik Forum Nr. 21, 2018, 16
[64] Vgl. a.a.O. Der Begriff „Fundamentalismus“ ist nicht eindeutig und wird zugleich als negativ besetzter Begriff verwendet. Das Interesse des Fundamentalismus besteht darin, die eigenen Grundlagen des Glaubens und der Lebensgestaltung zu bewahren. Aus diesem Grund werden absolute Werte und Grundlagen formuliert, die Antworten für alle Lebensbereiche geben können und so davor schützen, den eigenen Halt zu verlieren. Das Ziel ist, sich einen
„vermeintlich sicheren Weg durch das Dickicht einer komplexen Wirklichkeit zu bahnen
[65] Ebd.
[66] Christoph Barnbrock, 10 Thesen zur Zukunft des kirchlichen Lebens in der SELK: Wo geht´s hin?. Eröffnungspodium bei der Festveranstaltung 50 Jahre SEWLK am 25.06.2022 in Oberursel – noch unveröffentlicht.
[67] Ebd.
[68] Das Beispiel ist folgendem Werk entnommen: David Jordahl, Die zehn Ängste der Kirche, Stuttgart, 71
[69] A.a.O., 72
[70] Achim Behrens, Erik Braunreuther, Wolfgang Schillhahn, Augsburg für Anfänger. Fragen und Antworten zum Augsburger Bekenntnis, Hannover, 2006, 82
[71] A.a.O., 83. In vielen Kirchen sind die Stichworte „Aufklärung“ und „Vernunft“ eher negativ besetzt. Vgl. dazu das
scharfe Plädoyer für eine zeitgemäße Kirche von Martin Urban, Ach Gott, die Kirche. Protestantischer
Fundamentalismus um 500 Jahre Reformation, München 2016, 204f
[72] Diesen Gedanken entfaltet kurz David Jordahl in: Die zehn Ängste der Kirche, Stuttgart, 1993, 72
[73] Denkschrift der EKD: Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie. Der Staat des Grundgesetztes als Angebot und Aufgabe, 1985, 44 zitiert nach: Martin Honecker, Grundriß der Sozialethik, 1995, Berlin New York, 333
[74] Christoph Barnbrock, 10 Thesen zur Zukunft des kirchlichen Lebens in der SELK: Wo geht´s hin?.
Eröffnungspodium bei der Festveranstaltung 50 Jahre SEWLK am 25.06.2022 in Oberursel – noch unveröffentlicht.
[75] Christan Neddens, Good News in a „Fake News Word“?! Konfessionelle Kirche in unübersichtlichen Zeiten, in: Lutherische Theologie und Kirche, 43. Jahrgang 2019, Heft 2-3, Oberursel, 121f
[76] Liane Bednarz, Die Angstprediger Wie rechte Christen Gesellschaft und Kirchen unterwandern, München 2018, 240